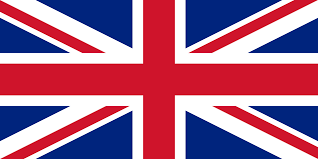Die Voraussetzung – der Staplerschein muss sein
In unseren Stapler-Kursen erwerben Sie alle Kenntnisse, die Sie als gut ausgebildeter Staplerfahrer in Handelsbetrieben, in Industrie- und Gewerbelagern und anderen Lagerstätten bei der Arbeit mit Staplern benötigen. Er wird immer und überall gebraucht wird, der Staplerschein ist eine wertvolle Zusatzqualifikation,
eine gute Investition in die berufliche Zukunft.
Staplerführerschein bedeutet: Bewegung mit viel Technik und Hydraulik. Im Stapler-Kurs erlangen Sie alle unentbehrlichen Fachkenntnisse für das Führen von Hubstaplern – auf der Basis des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und der Fachkenntnisnachweis-Verordnung.

Ungarisch Staplerschein
Ohne Staplerschein geht gar nichts
Zum Führen von Hubstaplern dürfen nur solche Arbeitnehmer eingesetzt werden, die eine entsprechende Fachkenntnis durch Zeugnis nachweisen. Im Klartext heißt das: der Staplerfahrer muss mindestens 18 Jahre alt sein, seine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung (20,5 Std.) und die Befähigung zum Staplerfahrer mit der bestandenen Prüfung (in Theorie und Praxis) und dem Erhalt des Staplerscheins abgeschlossen haben. Dieser Schein ist grundsätzlich zeitlich unbegrenzt gültig.
Theorie in zehn Schritten
Bei der theoretischen Ausbildung für den Staplerschein ist ein breites Wissen über rechtliche, technische und physikalische Zusammenhänge – den Vorgaben entsprechend – zu vermitteln unter anderen:
- Rechtliche Grundlagen – Überblick über Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften.
- Unfallgeschehen – Statistiken über Unfälle mit Staplern und Analysen zu Unfällen.
- Aufbau und Funktion von Hubstaplern und Anbaugeräten – Aufbau eines Hubstaplers, Unterschiede Gabelstapler und Kraftfahrzeug hinsichtlich Lenkung, Fahrverhalten und Antrieb, Funktionen von Anbaugeräten.
- Antriebsarten – Batterie-elektrischer Antrieb, Batteriewechsel und Laden bei elektrischem Antrieb, verbrennungsmotorischer Antrieb (Diesel, Benzin, Flüssiggas, Erdgas), Einsatz in komplett oder teilweise geschlossenen Räumlichkeiten.
- Standsicherheit – Schwerpunkt von Stapler und Last, Einfluss von Anbaugeräten, Standfläche, Anfahren, Kurvenfahrten und Bremsen, Einfluss von Bodenbeschaffenheit, Bereifung und Achskonstruktion, Wenden auf schiefer Ebene, Verhalten bei umstürzendem Gabelstapler.
- Betrieb allgemein – Betriebsanleitungen und -anweisungen, angemessene Fahrgeschwindigkeit, Verlassen des Staplers, mögliche Gefährdungen Dritter, Befahren von Steigung und Gefälle.
- Regelmäßige Prüfung – tägliche Sicht- und Funktionsprüfung, regelmäßige Prüfung durch Sachverständigen, Prüfnachweis, Prüfplakette.
- Umgang mit Last – Zustand von Last und Lastaufnahmemittel, Lastaufnahme, Umgang mit nicht palettierten Lasten, Einsatz von Lastschutzgittern und Fahrerschutzdach, Tragfähigkeit von Regalen, Sicht auf Fahrbahn, Transport hängender Lasten, Transport von Gefahrstoffen, Be- und Entladen von Fahrzeugen.
- Sondereinsätze – Verwendung von Arbeitsbühnen, Fahren im öffentlichen Raum, Verziehen von Anhängern, Einsatz im Tiefkühlbereich, Transport feuerflüssiger Massen.
- Verkehrsregeln/Verkehrswege – innerbetriebliche Verkehrsregelungen, Befahren von Laderampen, Aufzügen, Engpässen, Toren, Durchfahrten und Regalgängen sowie Überqueren von Gleisanlagen.
Praxis in sieben Schwerpunkten
Praktische Ausbildung mit sieben vorgegebenen Themenschwerpunkten, die vom Kurs-Teilnehmer unter Anleitung mit einem Hubstapler durchzuführen sind.
- Einweisung am Flurförderzeug – Stellteile für Fahren, Bremsen, Lenkung, Lasthandhabung, Sonderstellteile (Multifunktionshebel, Rücktasteinrichtungen), Sicherung und Sicherheitseinrichtungen.
- Tägliche Einsatzprüfung – Sichtprüfung, Funktionsprüfung.
- Lastschwerpunktdiagramm, Gewichtsverteilung und zulässige Lasten.
- Hinweise auf Gefahrstellen am Flurförderzeug – Hubgerüst, Zugang, Fahrzeugrahmen, bei Gabelaustausch, Batteriewechsel, Montage von Anbaugeräten.
- Gewöhnung an das Flurförderzeug – Einstellen Fahrersitz, Rückhalteeinrichtung, Anlassen/Starten, Betätigung aller Stellteile ohne Last.
- Verlassen des Flurförderzeugs – Sichern von Last und Gerät.
- Fahr- und Staplerübungen – hier sollen typische Fahr- und Stapelsituationen eingeübt werden. Unter anderem sollen Fahrten mit und ohne Last, vor- und rückwärts sowie Kurven- und Tor-Durchfahrten trainiert werden. Auch das Be- und Entladen sowie das Ein- und Ausstapeln von Palettenstapeln oder Gitterboxen an einem Palettenregal gehören zum praktischen Übungsteil.
Mehr dazu unter:
www.staplerschein-oesterreich.at

Kurzarbeit – Staplerschein