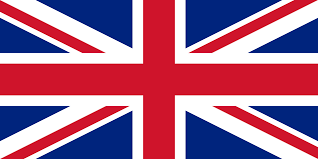Wenn Anbaugeräte den Stapler in einen Alleskönner verwandeln – darf die Sicherheit nicht verloren gehen

Staplerschein
Auf der sicheren Seite bleiben
Ganz gleich, ob es eine Gabelzinkenverlängerung, ein Sicherheitskorb oder ein Dreh-, Kippgerät ist – bei jeder Verwendung von Gabelstapler Anbaugeräten ist darauf zu achten, dass sich der Gesamtschwerpunkt des Staplers verschiebt. Normal liegt Schwerpunkt ohne Last etwa unter dem Fahrersitz.
Mit Last verschiebt dieser sich nach vorne. Gleiches geschieht bei Anbaugeräten – die Entfernung des Lastschwerpunktes zum Gabelrücken verschiebt sich nach vorn, der Gesamtschwerpunkt verlagert sich nach vorne. Die Folge: die Tragfähigkeit kann sich teilweise enorm verringern. Anbaugeräte können bis zu 800 kg auf die Waage bringen. Weitere Nachteile können die größeren Abmessungen und die Beeinflussung der Sicht sein. Es sei darauf hingewiesen, dass nur geeignete, geprüfte und zugelassene Anbaugeräte verwendet werden dürfen.
Mehr Nutzen – bedeutet mehr Verantwortung
Eine Kombi aus Stapler und Anbaugerät muss aufeinander abgestimmt sein – vor allem hinsichtlich der Tragfähigkeit, der Befestigung und den Hydraulikanschlüssen. Die Unterschiedlichkeit der Funktionen von Anbaugeräten, machen eine spezielle Unterweisung der Staplerfahrer zwingend erforderlich.

Hubstapler
Anbaugeräte unterliegen der Norm
Gabelstapler sind generell für Sonderaufgaben mit geeigneten Anbaugeräten ausrüstbar. Diese sind nach DIN-Norm bei älteren Geräten oder nach FEM-Norm seit ca. 1980 weltweit kompatibel.
Gängige Anbaugeräte sind neben verlängernden hohlen Gabel-Zinken, Schaufeln, Drehgeräte, Seitenschieber, Zinkenversteller, Papierrollen- oder Fassklammern. Anbaugeräte reduzieren die Resttragfähigkeit, die Reduzierung ist das Resultat aus Vergrößerung des Lastschwerpunktabstandes und des Eigengewichtes der Anbaugeräte.
Grundsätzlich:
Die Tragkraftreduktion kann mit der nachstehenden 4-stufiger Formel:
- Staplermoment MSt = Q · (X + C)
- Anbaugerätemoment ME = GE · (ESP + X)
- Restmoment MR = MSt − ME
- Resttragkraft G L = MR ÷ (X + V + L/2)
die Abkürzungen stehen für:
MSt = Eigenmoment Stapler
Q = Nenntragkraft des Staplers
X = Maß Mitte Vorderachse, Gabelträger-Rücken
C = Lastschwerpunkt (des Staplers)
MR = Restmoment
GE = Eigengewicht Anbaugerät
ESP = Eigenschwerpunkt Anbaugerät
GL = maximal zulässiges Gewicht der Last
V = Vorbaumaß des Anbaugerätes
L/2 = Schwerpunktabstand der Last
Diese mathematische Faktoren-Zusammenstellung sollte Sie nicht verwirren. Bei den Anbauteilen in der Bedienungsanleitung sind die notwendigen Größen meist bereits aufbereitet, sodass Sie es einfacher haben werden, mit diesen Anbauteilen. Diese Informationen sind nur als grundsätzliche Orientierung zu sehen.
Mit einem am Gabelstapler anzubringenden Resttragfähigkeitsdiagramm lässt sich die maximal zu hebende Last als Funktion der Hubhöhe ablesen. Wurde das Anbaugerät bereits ab Werk montiert und bildet eine schwer zu trennende Einheit mit dem ursprünglichen Gerät (insbesondere beim Seitenschieber), wird häufig das ursprüngliche Lastdiagramm weggelassen und durch das Resttragfähigkeitsdiagramm ersetzt.
Das Resttragfähigkeitsdiagramm enthält in der Regel die Gerätenummer des Typenschildes, das grundsätzlich an jedem Anbaugerät angebracht sein muss.

Stapler
www.staplerschein-oesterreich.at

Staplerschein