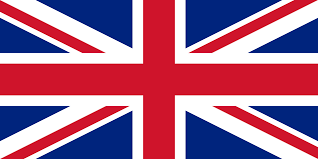Staplerschein Österreich
Be- und Entladen von Fahrzeugen mit dem Stapler
Es ist eine vertraute Feststellung, dass Staplerfahrer mit ihrem Arbeitsgerät Güter von B nach A transportieren. Hinzu kommt, dass Stapler immer häufiger zum Be- und Entladen von Fahrzeugen aller Art eingespannt werden.
Das Unfallrisiko ist ohnehin ständiger Begleiter der Staplerfahrer, geht es aber um das Be- bzw. Entladen von Kraftfahrzeugen, erhöht sich dieses Unfallrisiko wesentlich. Um Paletten auf einem LKW aufzunehmen oder abzusetzen, muss der Stapler über Laderampen oder -brücken fahren und hier sollte der Staplerfahrer wissen, was genauestens zu beachten ist.
Zwar überträgt der Gesetzgeber dem Unternehmer die Verantwortung dafür, dass Rampen, Brücken oder Ladebordwände in einem betriebssicheren Zustand sind, der Staplerfahrer aber steht im unkalkulierbarem Risiko.
Im täglichen Umgang mit Be- und Entladen von Fahrzeugen ist Planung und Einrichtung der wichtigsten Hilfsmittel, ursächliche Bedingung für einen reibungslosen Ablauf.
Laderampen, Ladeplattformen und fahrbare Rampen
Laderampen sind Einrichtungen, die dem Be- und Entladen von Fahrzeugen dienen. Sollen diese u. a. auch für Hubstapler nutzbar sein, ist eine Mindestbreite von 2,20 m vorgeschrieben (1,20 m Fahrbahn-Breite + 2 x 0,50 m beidseitiger Sicherheitsabstand).
Die Rampen sollten keinen größeren Steigungswinkel als 7 Grad aufweisen. Geeignete Maßnahmen, um ein Abstürzen des Staplers von der Rampenkante zu verhindern sind Leitplankensegmente oder vergleichbare Konstruktionen, die mindestens so breit sein sollten, wie die auf der Laderampe fahrenden Fahrzeuge. Ideal ist es, wenn die Laderampe überdacht ist, das erhöht die Gleitsicherheit des Hubstaplers. Rampen fordern zu jederzeit die volle Aufmerksamkeit des Staplerfahrers.
Ladeplattformen, die z. B. vor Laderampen oder seitlichen Toren für das stirnseitige Be- und Entladen von Sattelaufliegern oder Containern installiert werden, sollten zusätzlich mit einer Absturzsicherung für Stapler versehen werden, z. B. in Form eines an der Plattformkante angebrachten Radabweisers. Die Höhe des Abweisers sollte mindestens dem größten Rad-Durchmesser entsprechen, das auf der Plattform eingesetzt wird.
Fahrbare Rampen sind im Gegensatz zu festen Laderampen oder Ladeplattformen ortsveränderlich. An sie gelten in Bezug auf die Mindestbreite die gleichen Anforderungen wie für ortsfeste Rampen. Die Rampen sollten keinen größeren Steigungswinkel als 7 Grad aufweisen. Die ungesicherte Rampenkanten sind durch gelb-schwarze Schrägstreifen (Mindestbreite 10 cm) zu kennzeichnen, um diesen Gefahrenbereich weithin sichtbar zu markieren.
Sicheres Be- und Entladen von Fahrzeugen
Zeitdruck, ungenügende Absprachen und Missverständnisse führen häufig zu Unfällen bei Be- und Entlade-Vorgängen
Unternehmerin bzw. Unternehmer sollten vorab Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klären und diese dann schriftlich festlegen z. B. Weisungsbefugnisse, Nutzung und Instandhaltung von Arbeitsmitteln (Hubstapler, Hebebühnen), Ladungssicherung.
Beschäftigte dürfen Gabelstapler nur führen, wenn sie einen Staplerschein besitzen, geeignet und darin unterwiesen sind sowie durch die Unternehmerin oder den Unternehmer schriftlich beauftragt worden sind.
Sich über betriebsspezifische Regelungen und Gegebenheiten zu informieren kann Ärger ersparen z. B.: muss die persönliche Schutzausrüstung benutzt werden – wo soll das Fahrzeug abgestellt werden – herrscht im Betrieb ein generelles Rauchverbot.
Vor Ort klare und unmissverständliche Absprachen treffen. Fahrzeuge sind durch Betätigen der Feststellbremsen (auch am Anhänger oder Auflieger) sowie Anlegen von Unterlegkeilen gegen Wegrollen zu sichern – die Be- bzw. Entladeposition für das Fahrzeug zuweisen lassen – keine Verkehrswege oder Notausgänge zustellen – klappbare oder versenkbare Geländer, Haltegriffe, Laufstege, Stand- und Arbeitsflächen für das Begehen der Arbeitsplätze auf Fahrzeugen nutzen – persönliche Schutzausrüstung oder Warnkleidung zur besseren Sichtbarkeit tragen.
Aufenthalt im Gefahrenbereich
Beschäftigte dürfen sich beim Be- und Entladen nicht in Gefahrenbereichen aufhalten. Dazu gehören z. B.: abrutschende Ladung, sich absenkenden Aufbauten, ungesicherten Fahrzeugteile in geöffneter oder angehobener Stellung.
Immer daran denken, dass der Staplerfahrer durch die Ladung und den Hubmast eine erheblich eingeschränkte Sicht hat.
Mehr dazu auch unter:
http://www.staplerschein-oesterreich.at

Mst. Ausbildungsleiter Fuchshofer Martin