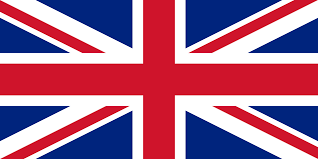Gabel- oder Hubstapler – Tragkraft und Tragfähigkeit
Faktoren, die beim Einsatz von Hubstaplern eine wichtige Rolle spielen sind, die Tragkraft und die Tragfähigkeit.
Die Tragkraft eines Hubstaplers ist seine Hubkraft, die setzt zusammen aus dem Eigengewicht der Konstruktion von Gabeln, Hubmastes und der Zuladung. Hinzugerechnet in die Tragkraft müssen vertikale oder horizontale Veränderungen der Lage, die sich beim Anheben, Absenken oder Absetzen von Lasten ergeben. Die Tragkraft wird meist in Kilogramm angegeben. Das vereinfacht unterschiedliche Geräte miteinander zu vergleichen und einzuschätzen.
Die Tragfähigkeit ist die maximal zugelassene Belastung eines Fahrzeuges bzw. der tragenden Bauteile – beim Stapler sind das die Gabeln und das Hubgerüst. Dynamischen Kräfte bleiben unberücksichtigt. Die Maßeinheit der Tragfähigkeit ist gleichfalls Kilogramm. Von Bedeutung ist bei einem Hubstapler vor allem das Verhältnis von Eigengewicht zur Tragfähigkeit. Unterschieden wird hier zwischen der Nenntragfähigkeit und derer tatsächlichen Tragfähigkeit (Traglast).
Nenntragfähigkeit und Traglast
Die Nenntragfähigkeit wird vom Hersteller angegeben und ist die zugelassene Last in Kilogramm, die mit dem Hubstapler aufgenommen oder angehoben werden kann.
Die reale Tragfähigkeit oder auch Traglast bezieht weitere Faktoren ein. Einzubeziehen ist die verwendete Ausrüstung, die Hubhöhe, der Lastschwertpunktabstand und die Reichweite. Der Hersteller ermittelt die Traglast in zahlreichen Standsicherheitsversuchen. Die Ergebnisse werden für jeden Hubstapler und jedes Anbaugerät in Tragfähigkeitsdiagrammen oder -tabellen dokumentiert und veröffentlicht.
Da im Betrieb Hubstapler und Last statischen und dynamischen Kräften ausgesetzt sind, wird zusätzlich wird ein sogenannter Stoßfaktor eingerechnet. Dieser Faktor muss in der Traglast berücksichtigt werden. Die Standsicherheit des Staplers muss dann zu gewährleistet sein, wenn beispielsweise beschleunigt oder gebremst wird, Schwingungen oder andere Kräfte auf die Last und Stapler einwirken.
Relevanz für die tägliche Arbeit
Auch wenn der Fahrer eines Staplers seltener die physikalischen Größen Tragkraft und Tragfähigkeit berechnen muss, für den Fahrer sind diese von höchster Wichtigkeit. Entscheiden diese doch darüber, ob der Stapler mit der Last sicher von A nach B gelangen, oder ob eine zu geringen Tragfähigkeit beim Anheben, der Last der Stapler hinten abhebt, instabil wird.
Um die volle Tragfähigkeit eines Staplers nutzen zu können, müssen die Gabelzinken immer vollständig unter die Last gefahren werden, der Gabelrücken muss anliegen. Wenn der Schwerpunkt der Last mittig liegt, wird die Traglast gleichmäßig verteilt.
Sollten Anbaugeräte zum Einsatz gelangen – Fassträger, Kranhaken oder Gabelzinkenverlängerung – ändert sich durch das Eigengewicht des Anbaugerätes und den veränderten Lastschwerpunktabstand die Nenntragfähigkeit. Dieses muss beim Einsatz von Anbaugeräten beachtet werden. Besondere Vor- und Umsicht ist notwendig.
Beispiel:
Ein Gabelstapler wiegt mit einer zulässigen Traglast von bis zu 2 Tonnen etwa das 1,5- bis 2-fache der zulässigen Last, also bis zu 2 x 2 t = 4 Tonnen
Ist die Tragfähigkeit höher, wird das Eigengewicht des Staplers erhöht, um die Standsicherheit sicherzustellen. Es beträgt dann 2 x 2 t plus der Differenz von 2 Tonnen zur jeweiligen zulässigen Tragfähigkeit.
Ein Stapler mit einer zulässigen Tragfähigkeit von 6 Tonnen wiegt also 2 x 2 t + (6 – 2 t) = 8 Tonnen.
Beachten:
Lasten sollten immer langsam und vorsichtig angehoben werden, um frühzeitig zu bemerken, dass der Stapler instabil wird. Das gilt besonders für unbekannte Lasten, bei denen nicht erkennbar ist, wo genau sich der Lastschwerpunkt befindet und beim Arbeiten mit Anbaugeräten.